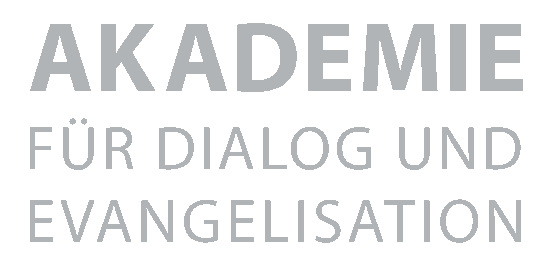Wien, 08.05.2025
Als Social Media noch in den Kinderschuhen steckten, galten sie als das Mittel für selbstermächtigte Mediennutzung, Mitsprache – und die Demokratisierung des Internets. Heute kommen Desinformation, Radikalisierung und Hetze nirgends so schnell in Umlauf wie auf eben jenen Plattformen, denen etwa im Arabischen Frühling noch so viel positive Gestaltungsmacht zugesprochen wurde. „Kontrolle, Macht, Demokratie – wer entscheidet über Social Media?“ – fragten Studierende ein hochkarätiges Podium im Figlhaus: Sigi Maurer, stellvertretende Clubobfrau der Grünen, diskutierte mit Andreas Grassl, einem der reichweitenstärksten österreichischen Journalisten auf TikTok und Daniela Pisoiu, Senior Researcher am Österreichischen Institut für Internationale Politik und Expertin für Radikalisierung und Extremismus.
„Erst kommt die Ästhetik, dann der Inhalt“
Was zählt auf Social Media? Dass Content wirklich King ist, bezweifelten immerhin zwei von drei Diskutant:innen auf dem Podium. „Früher war es wichtig, worin man gut war, welche Kompetenzen und Know-How man mitbrachte. Auf Social Media ist heute erfolgreich, wer ‚cool‘ ist“, sagt Extremismusforscherin Daniela Pisoiu über Erfolgsfaktoren im Netz: „Erst kommt die Ästhetik, dann der Inhalt“. Zuletzt sei das in Osteuropa aufgefallen, als quasi Unbekannte nur aufgrund erfolgreicher Social Media-Kampagnen über Nacht zu Wahlgewinnern wurden. Während die Grüne Parlamentsabgeordnete Sigi Maurer der Forscherin zustimmte und die Unterkomplexität kritisierte, die der Kürze der Videoclips geschuldet sei und durch die Verknappung keine seriöse Diskussion zuließe, betonte Journalist und TikToker Andreas Grassl die Wichtigkeit, dass auch Kräfte, die für Aufklärung und Information statt für Radikalisierung eintreten, versierter auf Sozialen Medien werden müssten.
Können wir uns noch auf gemeinsame Fakten einigen?
Soziale Medien und damit die Fragmentierung des medialen Angebots haben zu einer starken Zersplitterung dessen geführt, was früher als gemeingültige Wahrheit, als einend oder schlicht wichtig bezeichnet wurde. Kann es dafür einen Ausweg geben? Journalist und Tiktok-Influencer Grassl betonte, wie Social Media Nischen schmälere und Bubbles enger mache bis hin zu gefühlten Parallelwelten: „Früher konnte man sich über die Millionenshow oder Dancing Stars des Vorabends unterhalten und jeder wusste Bescheid. Durch Social Media werden heute in der HAK in Weiz Themen ganz anders diskutiert als in Wien, es sind ganz andere Inhalte relevant.“ Das einzige, das weiterhin universell bleibe, sei das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit, deren Erfahrungen sich allerdings vom Fußballplatz in die digitale Welt verschoben hätten. Obwohl Grassl selbst von seiner Präsenz auf Social Media profitiert, sieht er mehr echte Begegnungen als Schlüsselfaktor für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Kapitalinteressen als zerstörerische Kraft
Soziale Medien können Verbindungen über Kontinente hinweg schaffen, eine Vernetzung mit Gleichgesinnten, wie sie davor nicht möglich war – egal, ob auf Tiktok, Instagram oder X. „Das Problem sind die Kapitalinteressen der Plattformbetreiber“, sagt Grünen-Abgeordnete Sigi Maurer. Je aggressiver die Inhalte, desto mehr würden sie vom Algorithmus gepusht, denn das garantiert das Dranbleiben seitens der Nutzer:innen. Das stelle nicht das Einende in den Vordergrund, sondern das Agitierende, Geschäftsinteressen von Milliardären werden vor Gemeinwohl gestellt. Zur Verantwortung gezogen werden die Plattformbetreiber nur in unzureichender Form, was teilweise auch am fehlenden Verständnis für die Funktionsweise der Plattformen seitens der Gesetzgebung und Rechtsprechung liege. Der Digital Service Act (DAS) und der Digital Market Act (DMA) können die Grundlage für besser Regulation darstellen, so Maurer. Angewendet würden sie jedoch nicht konsequent genug. „Ich war nie für Verbote, habe mich immer dagegen ausgesprochen. Aber wir haben einen Punkt erreicht, an dem das systemische Problem der Kapitalinteressen nicht mehr über den individuellen Zugang lösbar ist. Das kann nur über eine Regulation der Plattformen erfolgen“, zeigt sich Maurer überzeugt.
Geschwindigkeit nimmt zu
Extremismusforscherin Pisoiu weist in Fragen des Umgangs mit Sozialen Medien auf die Relevanz der Aufklärung und Prävention im Schulalter hin. Zurzeit seien Schulbesuche von Expert:innen zu Themen wie Radikalisierung oder Verhetzung ein „nice to have“, kein Pflichtprogramm. Gepaart mit einer unzureichenden Demokratiebildung ortet Pisoiu einen starken Pull in Richtung Radikalisierung, die immer nach demselben Schema ablaufe. Gezeichnet werde eine katastrophale Situation, man stünde kurz vor dem totalen Abgrund: wirtschaftlich wie gesellschaftlich. Die Lösung sei immer der starke Mann, der Retter. Das Versprechen der Zugehörigkeit und Gemeinschaft zieht vor allem junge Menschen in den Bann, und die Spirale dreht sich schneller: „Radikalisierung dauerte früher zwei bis vier Jahre, heute wenige Wochen“, so die Forscherin. Durch die hohen Reichweiten seien derart gelagerte Radikalisierungstendenzen gesamtgesellschaftlich als gefährlicher einzustufen als physische Terrorakte.
Und jetzt?
Wie soll mit Sozialen Medien zukünftig umgegangen werden?
„Open Source für alle Algorithmen“, sagt Andreas Grassl.
„Keine Sozialen Medien für Nutzer:innen unter 16 Jahren“, will Sigi Maurer.
„Mehr Prävention und bessere Regulatorik“, wünscht sich Daniela Pisoiu.
Text von Susi Mayer